Illustratorin Larissa Bertonasco über kreative Krisen, Austausch und Support
22. Mai 2018
geschrieben von Anna Weilberg

Larissa Bertonasco wurde mit ihrer Diplomarbeit, dem illustrierten Kochbuch „La nonna, la cucina, la vita“ über die italienische Küche ihrer Großmutter, schlagartig erfolgreich. Sie illustrierte für Magazine, gestaltete weitere Bücher, Werbeanzeigen und Packaging. Parallel gründete sie zusammen mit anderen weiblichen Zeichnerinnen das Magazin „Spring“ – und ein Kollektiv. Wir besuchen die 45-Jährige in ihrem schönen Zuhause in Winterhude und sprechen darüber, warum sie vergangenes Jahr eine kreative Krise erlebte, und wie sie diese meisterte, warum ihr Zusammenarbeit mit anderen Frauen in der Kreativbranche so wichtig ist, und wieso sie sich vom Thema Italien beruflich lösen möchte.
femtastics: Du hast Italienisch in Siena studiert und deine Diplomarbeit an der HAW war das Kochbuch „La nonna, la cucina, la vita“. Woher kommt deine Liebe zu Italien?
Larissa Bertonasco: Mein Vater ist Italiener und in den Ferien sind wir immer zu meiner Oma nach Italien gefahren. Ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen, aber ich fand es dort so schön und habe immer besondere Vorstellungen von Italien gehabt. Nach dem Abi wollte ich dort leben. Also bin ich nach Siena auf eine Sprachschule gegangen und habe ein Jahr lang Italienisch gelernt. Dort habe ich erst festgestellt, wie deutsch ich eigentlich bin, das hat mich selbst überrascht. Ich habe mich immer gerne als Italienerin gesehen. (lacht) In Italien habe ich erst die vielen positiven „deutschen“ Seiten an mir entdeckt.
Welche sind das?
Ich habe in Siena in einer Mädels-WG gewohnt und die anderen haben tatsächlich von Plastiktellern gegessen, weil sie keinen Bock hatten, abzuwaschen! Auch die Stimmung dort hat mich gestört. Ich war in Aufbruchstimmung, war das erste Mal weg von zu Hause und wollte meinen eigenen Weg finden. Die jungen Italiener waren das Gegenteil: sie waren ständig bei ihren Familien, die Mamas haben noch deren Koffer gepackt! Viele Studentenstädte waren am Wochenende wie ausgestorben, es gab keine Studentenkneipen oder überhaupt ein Studentenleben. In den italienischen Großstädten ist es schon anders, aber ich persönlich hatte dort nicht das typische Studenten-Lebensgefühl. Da wollte ich wieder zurück nach Deutschland, aber in eine Großstadt.

Larissa lebt mit ihrer Familie in einem alten Pfarrhaus in Winterhude.
Erst in Italien habe ich festgestellt, wie deutsch ich eigentlich bin.

But first: Coffee! Larissa macht uns italienischen Kaffee.
Wieso hast du dich für Hamburg entschieden?
Es kamen für mich nur Berlin und Hamburg in Frage – und in Hamburg lebte auch eine Freundin von mir. Ich hatte das Gefühl, ich könne hier besser anknüpfen, in Berlin wäre ich erstmal ganz allein gewesen. Am Anfang war es trotzdem hart. Ich war ja nicht zum Studieren hier, ich habe gejobbt und war etwas orientierungslos. Ich hatte immer viele Interessen, wusste aber nie, was ich machen will. Irgendwann habe ich angefangen, an der Uni Italienisch und Kunstgeschichte zu studieren. Nebenbei habe ich eine Mappe für die Armgartstraße (HAW) vorbereitet, denn im Studium der Kunstgeschichte habe ich gemerkt, dass ich lieber selbst Kunst machen und nicht über Kunst reden möchte. Eigentlich traute ich mir das nicht richtig zu, arbeitete aber weiter an der Mappe und wurde schließlich genommen, da war ich schon 23.
Das heißt, du wusstest vorher nicht, dass du beruflich etwas Kreatives machen möchtest?
Doch, ich wusste schon, dass ich in Richtung Kunst und Kultur gehen wollte, aber ich hatte keine genaue Vorstellung. Freie Kunst war mir zu frei, insofern war Illustration schon ganz gut für mich.


Die Uhr in der Küche ist ein Kunstwerk von Larissas Mann.

Hast du schon während deines Studiums deinen Stil gefunden?
Es ist eine Reise, die nicht aufhört, wenn das Studium beendet ist. Es ist eine künstlerische Entwicklung – und wenn man diese ernst nimmt und nicht nur als Handwerk sieht, sondern als Spiegel seiner Persönlichkeit, dann kommt man gar nicht darum herum, sich immer weiterzuentwickeln. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass man nie irgendwo ankommt. Jetzt gerade bin ich in einer Umbruchphase, weil ich merke, dass mir das Kochbuchthema zum Hals heraushängt – ich kann keine italienischen Kochbücher mehr machen! Ich habe das Gefühl, schon zum hundertsten Mal eine Tomate gezeichnet zu haben, es wiederholt sich, das wird mir langweilig und mir fällt nichts mehr ein.
Eine kreative Krise?
Letztes Jahr hatte ich echt eine Krise, ich konnte gar nicht mehr richtig malen. Ich hatte keine Lust mehr und habe mich gefragt, warum ich das überhaupt noch mache. Es ist eh kein Beruf, mit dem man wahnsinnig reich wird, also muss wenigstens Leidenschaft und Herzblut dabei sein – und wenn das dann noch fehlt, es keinen Spaß macht und man kaum Geld verdient … Ich kam zum Entschluss, etwas ändern zu müssen, habe mich zurückgezogen und mich mehr mit mir als mit dem Zeichnen beschäftigt.
Es ist eh kein Beruf, mit dem man wahnsinnig reich wird, also muss wenigstens Leidenschaft und Herzblut dabei sein.
Worauf hast du denn jetzt Lust, was würdest du lieber machen?
Ich kann das thematisch gar nicht benennen, aber ich habe Lust auf etwas Neues, Lust auf mehr Austausch und Begegnungen mit anderen. Bei den Verlagen wie überhaupt in der Welt muss immer alles schnell schnell gehen, Hauptsache, die Bücher werden zügig fertig. Darunter leide ich, ich möchte die Dinge mit Ruhe, Sorgfalt und Leidenschaft machen, am Ende soll es gut sein! Ich habe auch total Lust aufs Unterrichten, nicht nur Skills weitergeben, sondern auch Erkenntnisse und Erfahrungen teilen. Ich habe Lust, das weiterzugeben, junge Studenten zu inspirieren. Es macht mir total Spaß, mit anderen zu arbeiten, ich habe auch schon ein paar Sommerakademien mit Studenten gemacht, das soll auch dieses Jahr wieder stattfinden.


Wenn man die Kunst ernst nimmt und nicht nur als Handwerk sieht, sondern als Spiegel seiner Persönlichkeit, dann kommt man gar nicht darum herum, sich immer weiterzuentwickeln. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass man nie irgendwo ankommt.

Austausch mit anderen erlebst du auch im Rahmen von „Spring“. Das Magazin und Kollektiv gibt es seit 2004 – wie kam es dazu?
Ich bin seit der ersten Ausgabe dabei. Ich wurde einfach gefragt. Ende 2003 habe ich mein Diplom gemacht und es war toll für mich, dass es nach dem Studium gleich weiterging mit der Arbeit in einer Gruppe.
Was war die Idee hinter „Spring“?
Die Comicszene ist total männerdominiert und wir wollten eine Plattform für Frauen schaffen. Nicht nur für Comics – was uns alle verbindet, ist die Zeichnung. Unter uns sind Comiczeichnerinnen, aber auch Illustratorinnen und freie Künstlerinnen. Die Bandbreite der verschiedenen Richtungen ist wichtig. Im Vordergrund steht das Erzählen mit Bildern. Wir machen immer ein Heft pro Jahr, bald erscheint die 15. Ausgabe! Wir verdienen kein Geld damit. Das, was erwirtschaftet wurde, fließt in das nächste Heft und in anstehende Projekte. So können wir manchmal eine Reise finanzieren, um beispielsweise in einem Haus auf dem Land zusammenzuarbeiten. Wir werden mittlerweile auch eingeladen: „Spring“ hat uns schon nach Toronto, Paris und Delhi geführt. Es ist so toll und motivierend, dass unser Projekt solche Früchte trägt.
Die Comicszene ist total männerdominiert und wir wollten eine Plattform für Frauen schaffen.
Du warst eine der Frauen aus eurem Kollektiv, die nach Delhi gereist ist. Was hast du dort gemacht?
Ich habe 2014 in Delhi einen Workshop für indische Zeichnerinnen geleitet. Das war gut ein Jahr nach dem Vergewaltigungsfall in Delhi, der weltweit durch die Medien gegangen ist und eine große Diskussion über die Rolle der Frau in Indien ausgelöst hat. Das Goethe-Institut hatte entschieden, einen Workshop zum Thema „Gender Issues“ in Delhi zu veranstalten. Die indischen Zeichnerinnen waren überwiegend sehr jung. Mit ihnen habe ich kleine Geschichten entwickelt für ein Buch mit dem Titel „Drawing Attention“. Es sind ganz verschiedene, meistens persönliche Geschichten der Frauen. Es war toll, zu sehen, wie jede ihren Weg fand, sich auszudrücken.
Was hast du persönlich aus dem Workshop mitgenommen?
Ich war zwar als Leiterin des Workshops da, hatte aber das Gefühl, so viel gelernt zu haben! Ich habe viel über mich selbst nachgedacht und über die Rolle der deutschen Frau. Man ist schnell geneigt, zu denken: Wir kommen aus einem so fortschrittlichen Land, also gehen wir mal nach Indien und zeigen den Frauen, wie es besser läuft. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich wirklich so fortschrittlich bin und worüber ich mich definieren lasse. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Frauen, die aus Ländern wie Indien kommen, mit diesen Themen viel bewusster umgehen, weil sie viel aktiver für ihre Rechte als Frauen kämpfen müssen. Hier beschäftigt man sich nicht zwingend damit, obwohl es noch so viel zu tun gibt! Viele Menschen denken immer noch, dass der Mann finanziell für die Familie sorgen und die Frau den Großteil der Kindererziehung übernehmen muss – und wenn die Frau ihren Mann oder ihre Familie verlässt, gibt es einen Aufschrei. Wenn aber ein Mann das macht, ist das ganz normal … Es gibt viele Dinge, die noch sehr eingefahren sind. Das alles hat mich zum Nachdenken angeregt und ich wollte das Projekt in Indien fortsetzen.

Larissas Atelier liegt in einem Zimmer in ihrer Wohnung.

Das Magazin soll nicht nur stylish und schick sein, sondern inhaltlich etwas transportieren. Unsere nächste Ausgabe steht unter dem Thema „Arbeit“, im Rahmen des Karl-Marx-Jahres.

Wie hast du das gemacht?
Ich hatte die Idee, mit acht Frauen aus unserem „Spring“-Kollektiv erneut nach Indien, diesmal Bangalore, zu fliegen, uns mit acht professionellen indischen Zeichnerinnen zu treffen und gemeinsam an unserer neuen Ausgabe zu arbeiten. Dafür habe ich ein Konzept entwickelt und dieses dem Goethe-Institut und anderen Stiftungen vorgestellt. Die fanden es alle gut, wir haben dann Unterstützung von einer Stiftung in Frankfurt bekommen, das Goethe-Institut hat Aufenthalt und Flüge bezahlt. 2016 haben wir das Projekt umgesetzt und daraus ist die Ausgabe „The Elephant in the Room“ entstanden, die mittlerweile auch in Indien erschienen ist.
Das heißt, das ganze Magazin und euer Kollektiv dienen nicht dem Zweck, Geld zu verdienen, sondern dienen dem Austausch und der Themensetzung?
Genau, und es muss vor allem Spaß machen! Jede von uns verdient anderweitig ihr Geld. Natürlich können sich über unsere Zusammenarbeit Kontakte und Jobs ergeben, aber das ist nicht der Hauptgedanke. Wir wollen etwas machen, was uns bewegt, worauf wir Lust haben. Der kollektive Austausch ist uns enorm wichtig. Es arbeitet nicht jede alleine zu Hause und gibt ihren Beitrag ab – das Magazin entsteht gemeinsam. Wir treffen uns in Berlin oder Hamburg, oder wir tauschen uns online aus, es findet immer ein Diskurs statt. Sowohl inhaltlich als auch ästhetisch. Das Magazin soll nicht nur stylish und schick sein, sondern inhaltlich etwas transportieren. Unsere nächste Ausgabe steht unter dem Thema „Arbeit“, im Rahmen des Karl-Marx-Jahres.
Ist euer Magazin politisch?
Wir werden immer politischer, wir hatten auch schon eine Ausgabe zum Thema Klimawandel. Für mich ist die Mitarbeit an „Spring“ eine Möglichkeit, mich an neue Dinge heranzuwagen und mich zu trauen, etwas Anderes zu machen, wie einen Comic beispielsweise. Sonst arbeite ich ja meist nach Kundenvorgabe.


Als Freiberufler hast du zwei mögliche Sichtweisen: Entweder siehst du alle anderen als Konkurrenz, oder du siehst alle als ein Team, eine Familie an.

Findest du diesen Zusammenhalt, den du beschrieben hast, in deiner Branche wichtig?
Total. Gerade als Freiberufler hast du zwei mögliche Sichtweisen: Entweder siehst du alle anderen als Konkurrenz, oder du siehst alle als ein Team, eine Familie an. Ich bin Verfechterin der Solidarität, man sollte gemeinsam für eine Sache kämpfen. Gerade in unserer Branche ist zum Beispiel das Thema Bezahlung immer schwierig, da muss man einfach zusammenarbeiten. Das finde ich bei „Spring“ so toll – klar gibt es auch mal Konflikte, aber es ist kein Zickenkrieg, wir unterstützen uns gegenseitig. Auch bei Jobs: Vielleicht passt ein Job-Angebot nicht zu mir, aber zu einer anderen aus unserem Kollektiv. Wir empfehlen uns gegenseitig. Ich denke, wenn man großzügig ist und gibt, dann kommt es auch zurück. Das schafft ein viel schöneres Lebensgefühl!
Das macht bestimmt auch glücklicher als neidisch auf andere zu sein und ihnen nichts zu gönnen.
Man sollte einfach akzeptieren, dass nicht jeder alles gleich gut kann. Das ist kein Grund, sich schlecht zu fühlen! Es ist wichtig, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. Letztes Jahr, als es mir nicht so gut ging, ich an allem gezweifelt habe und dachte, nichts zu können, habe ich so viele Rückmeldungen darüber bekommen, was ich alles kann! Das war total schön. Man nimmt oft gar nicht wahr, was man kann und was gut läuft. Man sollte nicht immer nur auf das schauen, was einem fehlt, nicht immer nur den Mangel betrachten.


Man sollte nicht immer nur auf das schauen, was einem fehlt, nicht immer nur den Mangel betrachten.

Wie finanziert ihr eure Magazine?
Wir finanzieren uns über selbst gestaltete Anzeigen, zum Beispiel für Galerien und Cafés. Wir fragen die Kunden, was sie sich vorstellen und gestalten dann eine Anzeige für sie. Sie bekommen das Original und die Anzeige im Heft.
Wenn du nicht an „Spring“, sondern deinen anderen, deinen eigenen Projekten arbeitest, arbeitest du von zu Hause aus. Wie funktioniert das für dich?
Ich liebe diesen Raum, aber manchmal ist es schwierig, Arbeit und Familienleben zu trennen. Meine Kinder kommen oft herein, wenn ich arbeite oder ich unterbreche meine Arbeit, um etwas im Haus zu machen. Meine beste Zeit zum kreativen Arbeiten ist zwischen 16 und 21 Uhr. Das ist aber genau die Zeit, in der alle zu Hause sind, man Abendbrot macht und eben Familienzeit hat. Deswegen muss ich versuchen, um 8 Uhr anzufangen und mein Tagespensum bis 14 Uhr zu schaffen, aber das fällt mir schwer. Mein Mann ist Künstler und hat zum Glück ein Atelier, sonst wäre es noch schwieriger. Mittelfristig möchte ich auch wieder in einem Atelier mit Kollegen und Kolleginnen arbeiten.



Arbeitest du lieber zusammen mit anderen als alleine?
Ich bin jemand, der Ruhe braucht, aber auch den Kontakt mit anderen. Beides in der richtigen Dosis. Wenn es zu viel ist, überfordert es mich schnell, weil ich recht viel wahrnehme. Das muss ich dann erstmal verdauen und verarbeiten, um es auch nutzen zu können. Wenn ich zu lange mit Gruppen unterwegs bin, brauche ich immer wieder Phasen, in denen ich mich zurückziehe und zeichne, über alles nachdenke, verarbeite und produktiv umsetze. Sonst macht es mich unzufrieden und ich habe das Gefühl, mental verstopft zu sein.
Was sind deine nächsten Projekte? Du arbeitest gerade an einem Hamburg-Buch, richtig?
Ja, der Carlsen Verlag ist auf mich zugekommen und hat gesagt, er würde gerne ein Buch mit mir machen, das Thema könne ich mir aussuchen. Eigentlich ein Traumprojekt, aber ich habe mich davon unter Druck gesetzt gefühlt, etwas total Perfektes abzuliefern. Da hast du einmal alle Möglichkeiten und denkst nur: Oh Gott! Ich fühlte mich auf einmal ganz klein. Mittlerweile habe ich aber eingesehen, dass ich schon viel Material für das Buch habe, ich muss es nur umsetzen. Der Titel wird „Heimathafen“ sein. Das ist ein bisschen abgedroschen, aber es geht eben um Hamburg und die Suche nach dem Ort, an den man gehört. Das ist in gewisser Weise auch mein Lebensthema: in Süddeutschland aufgewachsen, dann Italien, jetzt Hamburg … Ich will das alles vereinen und herausfinden, was es ausmacht, wenn man keinen Ort hat, an dem die Familie schon seit Generationen lebt. Das war bei mir nie gegeben, meine Mutter ist selbst in den 50ern mit ihren Eltern aus Dresden geflohen. Es ist also ein sehr persönliches Thema, das sich auch schon in meinem Kochbuch widerspiegelte.

Man muss sich einen Vertrauensvorschuss geben und dann wächst man in die Rolle hinein.
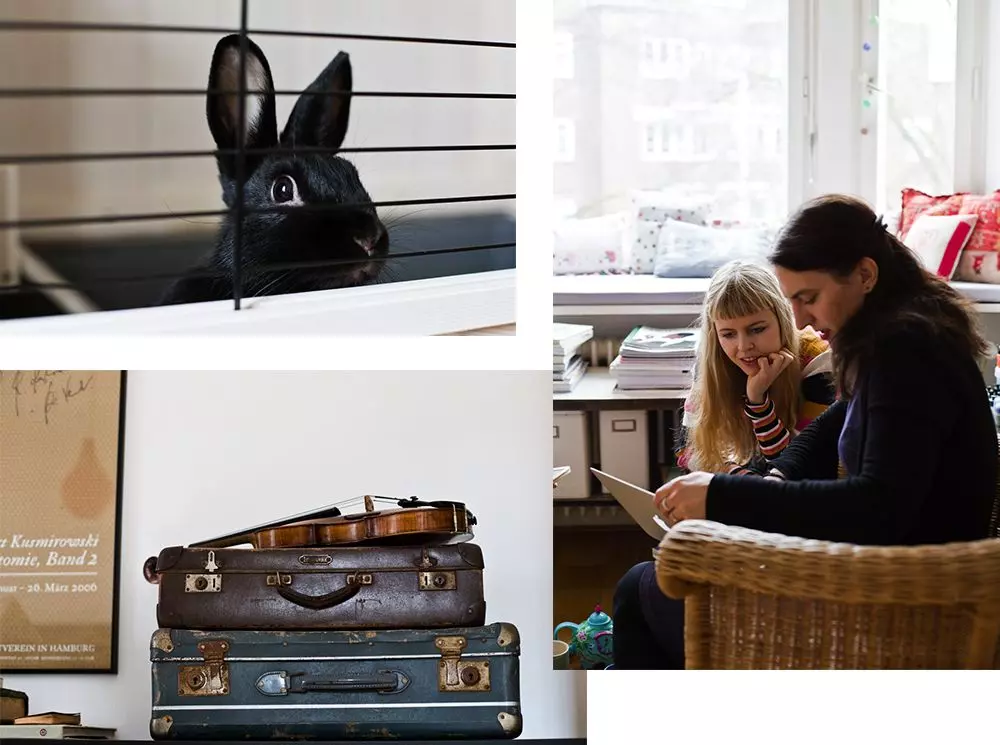
Rechts im Bild: femtastics-Praktikantin Lou und Larissa

Hast du einen Tipp für Illustratorinnen, die am Anfang ihrer Karriere stehen? Wie findet man seinen Weg und wird damit erfolgreich?
Dadurch, dass meine Diplomarbeit so erfolgreich war, war es für mich relativ leicht nach dem Studium. Ich hatte gleich viele Aufträge und Aufmerksamkeit, aber das kann man natürlich nicht planen. Es ist außerdem Fluch und Segen zugleich. Im Nachhinein finde ich das gar nicht so erstrebenswert, ich glaube, es ist gesünder, wenn man langsam hineinwächst, sich treu bleibt und keine Aufträge nur wegen des Geldes annimmt. Man sollte versuchen, sich selbst und seinen Zielen treu zu bleiben. Das ist mir passiert: Ich habe ganz viele Jobs bekommen, bei denen ich viel Erfahrung gesammelt habe, aber ich habe auch ein bisschen aus den Augen verloren, wo ich eigentlich mal hinwollte. Das versuche ich gerade wiederzufinden.
Hat sich deine Arbeit in eine Richtung entwickelt, in die du gar nicht gehen wolltest?
Alle wollten Italien und Kochbuch von mir. Irgendwann habe ich mich gefragt, ob ich das überhaupt bin und will. Ich wurde schnell in eine Schublade gesteckt und die funktionierte gut. Dabei hatte ich aber das Gefühl, dass mir etwas fehlte – und darauf sollte man hören. Man sollte sich darauf ausrichten, wo man hin möchte und auf das, was man sich wünscht; ein Selbstverständnis aufbauen.

Aber das braucht auch Selbstvertrauen!
Auf jeden Fall. Und als Frau neigt man eher dazu, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, nicht nur finanziell, sondern auch in Bezug auf das Vertrauen in die eigene Arbeit. Man muss sich einen Vertrauensvorschuss geben und dann wächst man in die Rolle hinein. Ich habe damals oft gedacht: Ich kann das nicht. Aber ich habe mich gezwungen, ins kalte Wasser zu springen. Und siehe da: Ich kann es ja doch! Man sollte immer einen Tick über das hinausgehen, was man sich zutraut. So viel hat man nicht zu verlieren, die Welt geht nicht unter und bestenfalls hat man etwas daraus gelernt. Natürlich sollte man sich auch nicht überschätzen, aber sich trauen und aus der Komfortzone herauskommen.
Wichtig ist Leidenschaft. Wenn die lodert, findet man auch sein Ding!
Wichtig ist Leidenschaft. Wenn die lodert, findet man auch sein Ding! Dem muss man auf der Spur bleiben und sich nicht verunsichern lassen. In unserer Gesellschaft ist leider oft das wichtig, was Geld bringt. Aber vielleicht muss man erstmal das Risiko eingehen, dass es kein Geld bringt – wie bei „Spring“ – aber im Endeffekt wirft es dann doch etwas ab, daraus entwickelt sich etwas und man geht dadurch vielleicht viel mehr in die Richtung, in die man gehen will!
Bist du eigentlich noch regelmäßig in Italien?
Ja, wir sind entweder im Frühling oder im Herbst dort. Ich habe immer noch viele Verwandte, wie meinen Vater und meinen Cousin, in Italien. Wenn ich durch die Kinder nicht mehr so gebunden bin, wäre mein Traum, für ein Projekt ein paar Monate lang in Italien zu leben. Im Herzen ist es meine zweite Heimat.
Vielen Dank für das interessante Gespräch, Larissa!
Hier findet ihr Larissa Bertonasco:
„Spring“ erscheint im Mairisch Verlag und lässt sich portofrei über die Verlags-Website bestellen.
Layout: Carolina Moscato