Perspektivwechsel – Filmemacher Emmanuel Amoako-Jansen porträtiert die Vielseitigkeit von Schwarzen Frauen
29. Juli 2020
geschrieben von Gastautor*in

Change of Perception – so lautet das Credo von Filmemacher, Singer-Songwriter und Medienproduzent Emmanuel Amoako-Jansen. Der 33-jährige Berliner hat dies in seinem Kurzfilm „Danke“ erneut unter Beweis gestellt. Der Film ist ein Debüt in zweierlei Hinsicht: Es ist nicht nur Emmanuels erster Kurzfilm, sondern auch eine der ersten mehrdimensionalen Darstellungen eines Schwarzen Liebespaares und des Innenlebens einer jungen Schwarzen Frau in Deutschland. Emmanuel schafft eine vielfältige Repräsentation, die frei von Stereotypen ist. Ob filmisch mit seiner Medienproduktionsfirma Iemagination oder musikalisch unter dem Künstlernamen Pennedhaus – er schafft immer wieder neue Ausdrucksformen, um eines anzustoßen: den Perspektivenwechsel. Wir haben mit dem Kreuzberger Kreativen außerdem über Toxic Masculinity, seinem Weg in die Selbstständigkeit und seine aktuellen Projekte gesprochen.
homtastics: Du bist als Medienproduzent, Filmemacher und Singer-Songwriter breit aufgestellt. Womit hat es angefangen?
Emmanuel Amoako-Jansen: Mittlerweile liegt mein Hauptfokus bei Filmen. Mit dem Schreiben und Produzieren von Songs hat alles angefangen. Mit 18 Jahren habe ich mir autodidaktisch beigebracht, Lieder zu schreiben. Später bin ich genauso beim Filmeschneiden vorgegangen. Es lag für mich nahe, von der Musik zum Film zu kommen, da es auch hier Takte gibt, die einem eine Orientierung für den Schnitt bieten können. Nach meinem Diplom in Musikmanagement habe mich 2015 dazu entschieden, mich in München und später dann in Berlin auf das Filmemachen zu konzentrieren. Musik ist und bleibt meine Leidenschaft. Ich weiß, wie viele Menschen ich dadurch erreichen kann – gerade um bestimmte Botschaften zu transportieren.
Wie bist du auf die Idee gekommen zu gründen?
2014 bin ich nach München gezogen, um ein halbjähriges Praktikum mit Option auf Übernahme bei ProSieben zu machen. In der Außendarstellung des Senders spielte Diversität immer eine Rolle. Als ich anfing dort zu arbeiten, gab es außer mir nur fünf weitere Schwarze Personen von insgesamt über 1.000 Menschen. Diese Umstände fand ich krass. Ich habe mich dazu entschieden, nicht weiter dort zu arbeiten. Ich wollte mir eine Unabhängigkeit verschaffen, auch wenn das bedeutet, dass mein Weg dadurch schwieriger wird. Letztlich war es mir wichtig, bei allem, was ich mache, in charge zu sein. Ich möchte mich zum Beispiel nicht bei der Auswahl der Models auf die immer wiederkehrende Optik reduzieren müssen. Wenn ich B- und POC-Models für einen Film vorschlage, möchte ich nicht Abstriche machen müssen, weil das Feedback von den Entscheidungsträgern nur weiße Models vorsieht. Es ist mir wichtig, dass sich Repräsentation auch in meiner Arbeit widerspiegelt, und so habe ich 2015 meine Medienproduktionsfirma Iemagination gegründet.
Wie hast du die Gründung erlebt?
Natürlich sind Ups and Downs mit einer Gründung verbunden. Ich habe mit meinen fünf Jahren Bestehen wahrscheinlich die Halbzeit erreicht. Man sagt ja, man braucht etwa zehn Jahre, bis es richtig gut läuft. Ich merke, dass die Dinge, an denen ich arbeite, immer mehr Form annehmen. Meine Einstellung dazu ist „trust the process“.
In deinem Kurzfilm „Danke“ geht es um Black Love. Warum ist es dir wichtig, dich diesem Thema zu widmen?
Weil man es in der deutschen Medienlandschaft nirgendwo findet. Als Jugendlicher war ich oft in den USA zu Besuch bei meiner Familie und habe dort Filme wie „Love & Basketball“ oder „Love Jones“ gesehen. Diese Filme gehören zwar auch in den USA nicht zum Mainstream, aber es gibt sie und sie sind verfügbar. Diese Filme haben mich beeinflusst, weil sie Menschen wie mich ganz normal darstellen, wie sie wirklich sind. Ich bin ein Schwarzer Mann, der ziemlich ruhig ist und sich sehr über Emotionen ausdrückt. Eine Repräsentation hierzu suche ich in deutschen Filmen vergebens. Schwarze Männer erscheinen hier oft stereotyp, zum Beispiel als der lockere Fitness-Coach oder der Typ, der zeitgleich drei Freundinnen hat und nichts auf die Reihe bekommt.
Schwarze Männer werden oft in Klischees widergespiegelt, während eine darkskinned Schwarze Frau in den Medien einfach nicht vorkommt.
Du beschäftigst dich auch mit dem Bild der Schwarzen Frau. Warum?
Es ist mir sehr wichtig anzuerkennen, dass ich nicht für Schwarze Frauen sprechen kann. Nichtsdestotrotz möchte ich sie in meiner Arbeit darstellen, weil sie den wichtigsten Part in der Thematik Schwarze Männlichkeit spielen. Viele Männer, die so aussehen wie ich, denken bei der Vorstellung von einer darkskinned Schwarzen Frau an ihre Mütter und selten an sich selbst in einer weiblichen Form. Ich habe diesen Prozess durchlaufen und feststellen müssen, dass das eigene Selbstwertgefühl hier eine Rolle spielt. Zu der noch tiefer gehenden Reflexion hat auch meine Freundin Joy beigetragen. Ich habe ihr zugehört und einen Eindruck davon bekommen, wie sie als deutsche, Schwarze Frau durchs Leben geht und welche Perspektiven sich daraus ergeben. Ich habe erkannt, wie unsichtbar die Schwarze Frau ist, die in Deutschland aufgewachsen ist. Schwarze Männer werden wie gesagt oft in Klischees widergespiegelt, während eine darkskinned Schwarze Frau in den Medien einfach nicht vorkommt. Wenn Schwarze Frauen zu sehen sind, sind es eher lightskinned Schwarze Frauen. Aber auch hier ist keine dabei, die mal eine Rolle spielt, welche unabhängig von ihrer Optik für sich steht, zum Beispiel als Rechtsanwältin.
Der Kurzfilm „Danke“ ist im Februar erschienen und wurde von Emmanuels Produktionsfirma ATR realisiert.
Wie ist die Resonanz zu „Danke“ gewesen?
Der Film wurde im Goethe Institut und bei dem „European Film Festival Ghana“ in Accra und Kumasi gezeigt. Die Resonanz war sehr gut und ich habe viele Rückmeldungen zu den Screenings erhalten. In Berlin habe ich im Rahmen des „Black History Month“ ein Screening mit anschließender Panel-Diskussion veranstaltet. Auch hier war die Resonanz supergut. Als ich den Film zuvor Einzelpersonen gezeigt hatte, habe ich sehr emotionale Reaktion wahrgenommen. Bei dem Screening in Deutschland war ich das erste Mal dabei, während eine größere Gruppe von Menschen meinen Film sah. Damals war ich an einem Punkt, an dem ich ihn schon zu oft gesehen und bearbeitet hatte. Umso erfrischender war es, meinen Film durch das Screening von außen betrachten zu können und die Reaktionen direkt mitzuverfolgen.
Welche Themen wurden bei dem Panel diskutiert?
Die erste Panel-Diskussion fand zu den Themen Visibilität und Repräsentation statt. Nach dem Screening haben wir die zweite Diskussion über den Film mit allen Mitwirkenden geführt. Die meist diskutierte Frage aus dem Publikum war, wie das Filmende zu verstehen sei. Konkret ging es um die Aussage „Danke.“ von der weiblichen Hauptrolle als Antwort auf das „Ich liebe dich.“ des männlichen Hauptcharakters. Es war schön zu sehen, dass die Leute durch diese Frage ihren eigenen Film haben weiter laufen lassen.
Ich mache meine Filme und Musik um Schwarze Kinder zu inspirieren und ihnen zu zeigen, dass sie ganz sie selbst sein können und nicht in eine Rolle schlüpfen müssen, von der sie denken, dass andere sie gerne dort sehen würden.
Es ging mir ähnlich. Was möchtest du noch mit deiner Arbeit bewirken?
Ich mache meine Filme und Musik um Schwarze Kinder zu inspirieren und ihnen zu zeigen, dass sie ganz sie selbst sein können und nicht in eine Rolle schlüpfen müssen, von der sie denken, dass andere sie gerne dort sehen würden. Ich möchte etablieren, dass man einfach ehrlich sein kann. Man muss als Musiker nicht irgendwen beleidigen oder sein Video an einer Tankstelle drehen, um cool dazustehen. Man kann es auch gefühlvoll machen und ich denke, dass es genug Menschen in Deutschland gibt, die das checken.
Mein Motto ist „Change of perception“. Ich sehe mich in einer Brückenfunktion, weil ich in einem ghanaischen Haushalt in Haan, Nordrhein-Westfalen groß geworden bin. Ich verstehe beide Welten, kann in Codes sprechen und so beide Seiten aneinander führen und Dialoge eröffnen. Durch den Film „Danke“ bringe ich Leute viel eher zum Nachdenken als dadurch eine Diskussion über Rassismus zu führen. In meinen Arbeiten werden Schwarze Menschen so dargestellt wie sie sind – offen, transparent und unapologetically authentisch. Es wird nicht mit Fingern gezeigt und so lernt die andere Seite viel mehr.
Apropos gefühlvoll: Du stehst auch dafür, als Mann offen Emotionen zu zeigen. War das schon immer so?
Ich befasse mich mit Toxic Masculinity und hinterfrage viel. In dem Zusammenhang sehe ich viele Parallelen zu meinem Background. Ich lebe in einer Welt, in der mir gewisse Dinge als Gegebenheit beigebracht wurden. Als ich mich selbst auf die Suche nach meiner individuellen Geschichte begab, habe ich festgestellt, dass vieles von dem, was mir erzählt wurde, für mich nicht stimmt. Ich hinterfrage meine eigenen Reaktionen oft. Und auch wenn ich sehr bemüht bin mich selbst zu reflektieren, merke ich noch immer, dass ich Züge aus meiner Sozialisierung habe, die ich nicht so leicht los werde. Es ist wichtig, sich als Mann diese Vorstellungen von Männlichkeit bewusst zu machen.
Die Gesellschaft steckt einen ziemlich engen Rahmen, wenn es darum geht, wie ein Mann sein sollte. Es scheint in Deutschland nur zwei Extreme für die Rolle des Mannes zu geben. Entweder ist der Mann der aktive Versorger oder er ist sehr emotional – was auch immer das heißen mag – und passiv.
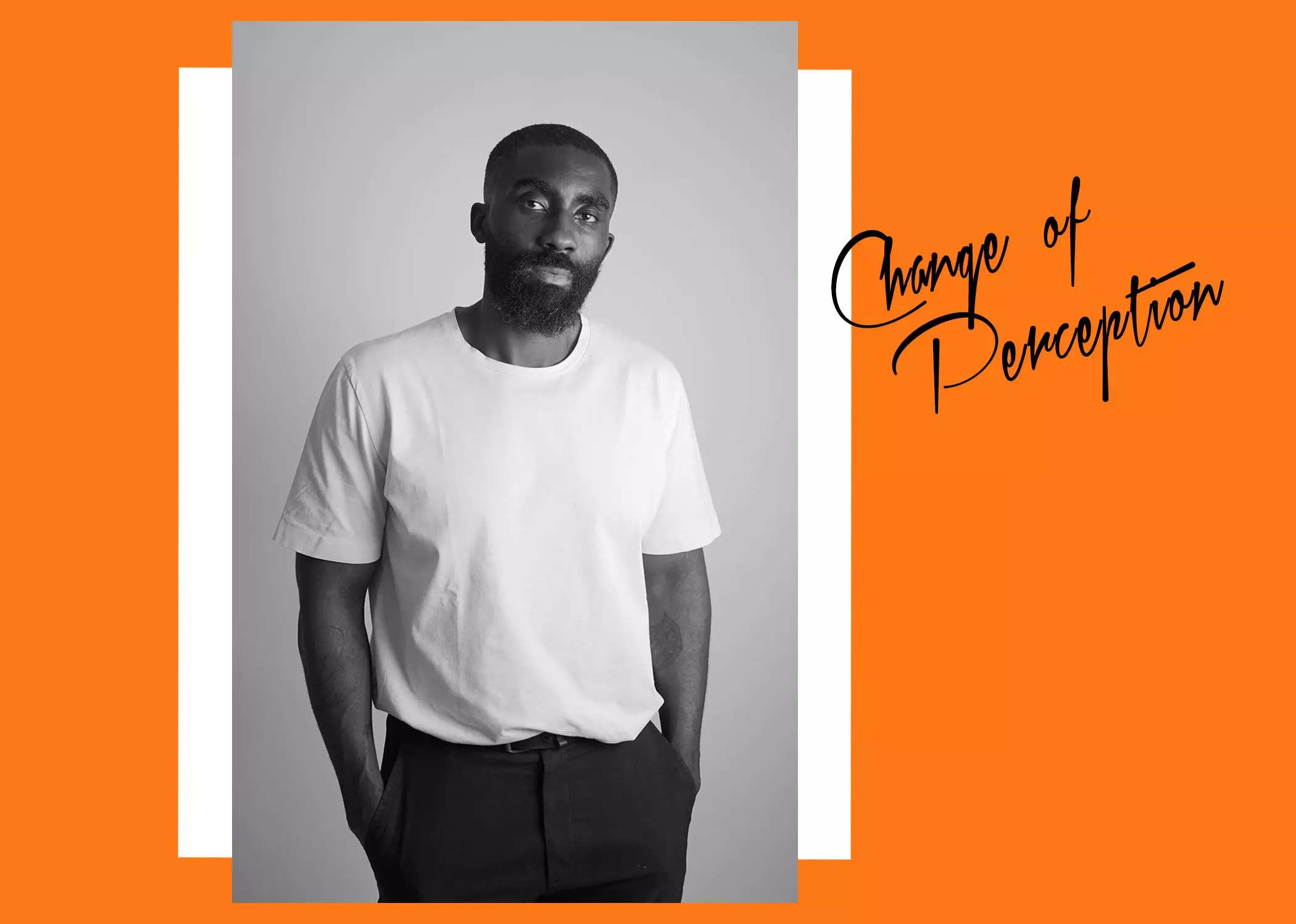
Welche Vorstellungen sind das?
Die Gesellschaft steckt einen ziemlich engen Rahmen, wenn es darum geht, wie ein Mann sein sollte. Es scheint in Deutschland nur zwei Extreme für die Rolle des Mannes zu geben. Entweder ist der Mann der aktive Versorger oder er ist sehr emotional – was auch immer das heißen mag – und passiv. Ich glaube an eine ganz große graue Zone. Ich bin sehr gerne der Mann, der versorgt und der die Tür aufhält, aber auf der anderen Seite bin ich auch der Mann, der offen über seine Gefühlswelt redet, was mich nicht unmännlicher macht. Ich bin einfach eher im Einklang mit meiner femininen Seite. Es gibt dazu eine große Fehlinterpretation von der Gesellschaft. Viele schauen mich erstaunt an, wenn ich in einem Gespräch davon erzähle, dass ich geweint habe oder gewisse Dinge hinterfrage. Der Druck sich als starker, harter Mann zu präsentieren, ist in der Community allein schon dadurch größer, dass Schwarze Männer in der Nahrungskette nicht gerade weit vorne stehen. Mit dieser Perspektive auf die Welt, habe ich den männlichen Hauptcharakter des Films – Malick Bauer – bewusst nicht als harten Kerl dargestellt. Lewis Gaspar Biade Antebe, der die Nebenrolle spielt, ist der typisch sozialisierte Schwarze Mann. Und der war ich auch zu 100 Prozent.
Was war die tollste Erfahrung, die du mit deiner Arbeit bisher gemacht hast?
„Danke“ ist ein Film, der beabsichtigt, die Schwarze Frau in Deutschland auf eine vielfältige Art darzustellen. Als liebende, ganz normale, kultivierte Person. Vor den offiziellen Screenings habe ich verschiedenen Leuten den Film bei mir zuhause gezeigt. Die Schwarzen Frauen darunter haben alle geweint. Und das fand ich krass. Viele hat es so getroffen, weil sie das Gefühl hatten, dass es ihre Realität widerspiegelt. Ich fand es toll, zu merken, dass ich als Einzelperson ziemlich viel bewirken kann.
Wenn man Geschichten erzählt, sollte man sich immer in die Sphären derjenigen begeben, um die es geht. Das macht einen guten Storyteller aus.
Wie bist du bei den Vorbereitungen zu dem Film vorgegangen?
Die Hauptautorin der Geschichte ist eine gute Freundin von mir, Ella Essien. Es war superwichtig, sie an Bord zu haben, denn sie ist eine Schwarze Frau. Hauptgeschichtenerzähler haben die Verantwortung, die Dinge richtig zu erzählen. In meinem Beispiel bedeutet das, dass ich mir als Mann aus erster Hand Informationen von einer Schwarzen Frau geben lasse, denn nur so kann ich der Darstellung gerecht werden. Wenn man Geschichten erzählt, sollte man sich immer in die Sphären derjenigen begeben, um die es geht. Das macht einen guten Storyteller aus. Authentizität ist unglaublich wichtig. Sonst besteht die Gefahr, dass Geschichten zugunsten bestimmter Menschen geschrieben und daher missinterpretiert werden.
Woher ziehst du deine Motivation?
Aus dem Leben und den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Es sind die kleinen Momente, die ich für mich alleine hatte, in denen ich reflektiert habe, die mich motivieren. Ich ziehe Motivation aus meiner eigenen Geschichte. Ich weiß, woher ich komme, ich kenne die historischen Hintergründe Ghanas und bin regelmäßig dort. Das ist meine Motivation: Zu zeigen, wer wir sind und was wir machen. Anstatt diese Geschichte immer wieder erzählen zu lassen, möchte ich eigene Geschichten erzählen.

Wie lässt du dich für deine Arbeit inspirieren?
Ghana spielt auch hier eine große Rolle für mich und inspiriert mich sehr. Ich war letztes Jahr dort und habe mich während ich unterwegs war mit vielen Uber-Fahrern unterhalten. Dabei haben viele Männer offen über ihre Emotionen gesprochen, zum Beispiel über Themen, die sie traurig machen. Zu wissen, dass es in Ghana anders ist als es das Fremdbild vorgibt, ist eine große Inspiration für mich.
Rassismus wird aktuell zwar auch in Deutschland thematisiert, allerdings werden nur die Aspekte rausgepickt, die gerade verdaulich sind.
Du hast mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass Rassismus in Deutschland nur oberflächlich angegangen wird. Siehst du das bei der „Black Lives Matter“-Bewegung auch so?
Ja, der Rassismus wird sehr oberflächlich behandelt. Deutschland ist da noch weit zurück, weil nie wirklich darüber geredet wurde. Es hieß immer: „Es ist nicht so schlimm bei uns.“. Es hat sich – natürlich auch durch die Geschichte bedingt – ein rassistisches Gut eingeschlichen. Die Kolonialgeschichte sollte Teil des deutschen Geschichtsunterrichts sein. Das erste Konzentrationslager wurde im heutigen Namibia vom Deutschen Reich gebaut. Der erste Genozid des 20. Jahrhundert hat dort stattgefunden. Die Uniformen der Kolonialherren wurden als erste Uniformen der SS von den Nazis genutzt. Das zeigt schon, wie verbunden die rassistischen Taten miteinander sind. In Berlin am Platz der Sonne wurde Afrika zwischen den Kolonialmächten aufgeteilt. Aber darüber redet keiner. Rassismus wird aktuell zwar auch in Deutschland thematisiert, allerdings werden nur die Aspekte rausgepickt, die gerade verdaulich sind. Ein gutes Beispiel ist das Thema Racial Profiling. Die mediale Berichterstattung geht mal das Risiko ein, dass die Polizei ihr Fett wegbekommt, aber sehr viel tiefer wird dabei auch nicht gegangen. Generell würde ich sagen, dass der erste Anstoß mit der „Black Lives Matter“-Debatte gegeben ist. Dennoch sind die geführten Debatten sehr oberflächlich.
An welchen Projekten arbeitest du gerade?
Ich habe zusammen mit meinem Partner Matteo Capreoli, der gleichzeitig einer meiner besten Freunde ist, dieses Jahr das Musiklabel nownow gegründet. Hierunter hat Matteo ein Instrumental Album und ich meine erste deutschsprachige Solo-Single „Azonto“ veröffentlicht. Zudem bin ich Teil eines Start-ups, welches mittlerweile unter dem Namen Agian läuft. Wir bauen eine Plattform auf, bei der es darum geht, dass Investoren sich an afrikanischen Firmen beteiligen, damit diese wiederum expandieren können. Länder wie Ghana und Nigeria haben viel Potenzial. Wir waren im November in Ghana und haben dort mit einem deutschen Partner einen Start-up-Inkubator veranstaltet, bei dem wir verschiedene Start-ups aus Nigeria und Ghana kennengelernt haben. Uns geht es dabei darum, dass Business auf Augenhöhe betrieben wird. Damit wollen wir dazu beitragen, dass das bisher bekannte Narrativ des Spendens nicht mehr so sehr im Vordergrund steht. Zudem trägt Charity dazu bei, dass die Wirtschaft in den Empfängerländern nicht genügend angekurbelt wird.
Was planst du für die Zukunft?
Ich manage eine ghanaische Soul Afrofusion Band, auf deren Release und Impact ich mich sehr freue. Langfristig möchte ich definitiv weiterhin Filme machen. Ich möchte innerhalb der nächsten fünf Jahre ins deutsche Kino. Auf meiner Bucketlist steht auch, dass ich einen Grammy bekommen möchte – selbst wenn ich nur eine Zeile geschrieben habe. In der Zukunft würde ich gerne Kulturminister Ghanas werden und noch mehr zu dem Austausch zwischen deutscher und ghanaischer Kultur beitragen. All das führt dazu, dass mehr Verständnis für einander aufkommt und die Kommunikation verbessert wird. Ich würde gerne dazu beitragen, innerhalb der nächsten 25 Jahre eine gute Foundation aufzubauen, die Rassismus keinen Nährboden bietet.
Vielen Dank für das interessante Gespräch und weiterhin viel Erfolg, Emmanuel!
Hier findet ihr Emmanuel Amoako-Jansen:
Fotos: Joy Édéma Otekpen